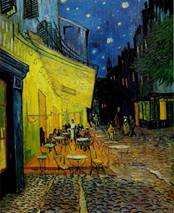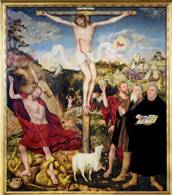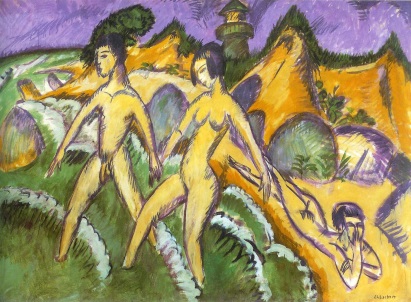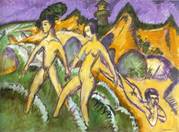|
|
Vortragsreihe: Mit System verrückt .... Oder: Über die Lesbarkeit von Kunst |
Van Gogh? Ach ja, dieser Irre, der sich das Ohr
abgeschnitten hat .... ! - Dali? Noch so’n Abgedrehter, aber malen konnte der ...
! - Michelangelo? War das nicht der mit der Sixtinischen Kapelle? Wahnsinn, so
viele Quadratmeter - und alles alleine - na ja, ... ! Kandinsky? Da hängen zwei
Poster bei uns im Büro, irgend so was Geometrisches, alles ziemlich
durcheinander, macht sich da aber ganz gut ... - !
Unzählige Definitionsversuche, viel Irritation und
jede Menge „kunsthistorische Lyrik“ haben das Phänomen Kunst bisher begleitet und geprägt, (zu) viele Generationen haben
mit einem Pinsel- und Tuschkasten-Trauma ihre Schulkarrieren beendet und
seitdem für Kunst und Künstler allenfalls noch ein süßsaures Lächeln übrig.
Demgegenüber verzeichnen groß angelegte
Ausstellungsprojekte und museale Neugründungen Rekord-Besucherzahlen. Sind
letztere eher Ergebnis cleveren Marketings oder Ausdruck eines buchstäblich
massenhaften Grundbedürfnisses, der Kunst näher zu kommen, sie (endlich einmal)
zu verstehen?
Die Ziele der auf mehr als 20 Abende angelegten
Bild-Vortragsreihe ergeben sich denn auch aus der Grundauffassung der Kunst als Sprache. Das, was auf
den ersten Blick dem Zufall entsprungen zu sein scheint, gibt oft erst auf den
zweiten oder gar dritten Blick seine auf eine ganz spezielle Wirkung zielende
Komposition preis, die auf der ganz gezielten Anwendung künstlerischer
„Sprachelemente“ beruht. Entdeckt man diese, dann kann Kunst geradezu zur
Offenbarung werden!
Es ist nun einmal ein Ammenmärchen, dass Kunst
grundsätzlich „zweckfrei“ sei oder zu sein habe. Auch dass der Künstler fast
immer als Randfigur der Gesellschaft gesehen wird, der sich mangels einer
besseren Idee und gegen alle Ratschläge der Verwandtschaft der „brotlosen
Kunst“ widmet, bedarf sicher einer differenzierteren Sicht; die
Beurteilungskriterien für Goethes „Faust“ und das Telefonverzeichnis von
Lüdinghausen dürften sich auch unterscheiden, obwohl beide gleichermaßen als Druckerzeugnisse
vorliegen….!
Es ist deshalb das Anliegen des Referenten - selbst
akademisch ausgebildeter Künstler und promovierter Kunsthistoriker - dem
interessierten Laien einen Schnupperkurs durch den kunsthistorischen
Gemüsegarten von der Antike bis in die Gegenwart anzubieten, um zu zeigen, dass
die Kunst ein großes zusammenhängendes organisches Ganzes bildet, in dem nichts
voraussetzungslos entstand und entsteht, und dass ihre Erzeugnisse - seien sie
Architektur, Skulptur oder Gemälde - nicht wie vereinzelte Fettaugen auf einer ansonsten
eher mageren historischen Brühe schwimmen, sondern einem roten Faden folgen.
Dieser ist für das sensibilisierte Auge deutlich sichtbar in das Band der
Menschheitsgeschichte eingewebt, einer Geschichte, der die Kunst in
faszinierendster Weise sowohl die Fackel voran als auch die Schleppe
hinterhergetragen hat.
Interessiert? Da lässt sich was machen!
Termine
Winter-Frühjahr 2025/2026
|
Montag,
08.12.2025 Beginn: 19:00 h
|
Mit
System verrückt Oder:
Über die Lesbarkeit von Kunst Teil 10 Die Sixtinische
Kapelle als Gesamtkunstwerk Oder: Mose zwischen
Urknall und Jüngstem Gericht |
Rheine Vortragssaal der
VHS Neuenkirchener
Str. 22 |
Man
schreibt das Jahr 1475 – und das hat es aus kulturhistorischer Sicht gleich
in mehrfacher Weise wirklich in sich: Papst Sixtus IV. ruft ein „Heiliges
Jahr“ aus und auf den Grundmauern der mittelalterlichen Cappella Grande im Vatikan wird im Frühjahr mit dem Bau einer
neuen Kapelle begonnen, die den Namen ihres Erbauers unsterblich machen soll,
die Sixtina! Nahezu zeitgleich kommt am 6. März im toskanischen Caprese ein
kleiner Junge zur Welt, den diese später als ihren wohl begnadetsten Künstler
aller Zeiten feiern und dessen Name heute stets in einem Atemzug mit diesem
Gebäude genannt wird: Michelangelo! Wenngleich der Grundkanon der bildlichen
Ausgestaltung der Kapelle nicht durch ihn ausgeführt wurde, so kann er doch
als deren alles überragender Vollender gelten. Ironie des Schicksals: Michelangelo hat
sich den Auftrag (eigentlich waren es sogar zwei) der Ausmalung nicht
gewünscht; nach eigenem Bekunden hat er ihn bzw. sie sogar regelrecht gehasst
– und er lässt den sensibilisierten Betrachter seiner Meisterwerke noch heute
an seiner teils subtilen, teils drastischen malerischen Rache teilhaben! Aber
der Reihe nach: Dem Referenten wird es darum gehen, eine Vielzahl
bildsprachlicher Vokabeln in einem großen Zusammenhang lesbar und
verständlich zu machen. Im gigantischen Bildprogramm der Sixtina werden nicht
nur Szenen des Alten und des Neuen Testaments in ihrer besonderen Abstimmung
aufeinander, sondern auch in ihrer macht-politischen Indienstnahme durch
Papst und Kirche erkennbar, bei der man nichts dem Zufall oder gar einer
ungesteuerten Macht überlassen wollte. Nur genau da hatte man sich dann bei
Michelangelo gehörig verrechnet! |
|
Montag,
12.01.2026 Beginn: 19:00 h
|
Mit
System verrückt Oder:
Über die Lesbarkeit von Kunst Teil
11 Michelangelo
II, Raffael und Leonardo – Giganten der Renaissance |
Rheine Vortragssaal
der VHS Neuenkirchener
Str. 22 |
Eines
vorab: Es wäre vermessen, wollte man die Werke dieser drei wahrlich
übergroßen Gestalten der Wissenschaft (!) und Kunst an nur einem Abend auch
nur annähernd erschöpfend behandeln, es könnte einfach nicht gelingen. Wir
werden dennoch den Versuch unternehmen, anhand von Schlüsselwerken den
genialen Denkweisen und bildnerischen Erfindungen dieser drei Großen
nachzuspüren, sie zu erschließen und zu lesen. Dabei könnte es passieren,
dass selbst vermeintlich „ganz bekannte“ Werke wie Raffaels Schule von Athen oder Leonardos Abendmahl sich in ihrem ganz
spezifischen Kontext als etwas entpuppen, was man nicht einmal im Traum für
möglich gehalten hätte. Beispiel? Das Abendmahl
ist ein Wandbild in einem ehemaligen Speisesaal eines Klosters, in letzter
Konsequenz aber gar nicht für die dort speisenden Mönche gedacht und gemacht
worden! Es enthält nämlich eine hochgradig politische Botschaft … aber
das klären wir dann alles! |
|
Montag,
26.01.2026 Beginn: 19:00 h
|
Mit
System verrückt Oder:
Über die Lesbarkeit von Kunst Teil
12 Die
Renaissance nördlich der Alpen von van Eyck bis Grünewald Insbesondere:
Der
Isenheimer Altar |
Rheine Vortragssaal
der VHS Neuenkirchener
Str. 22 |
Für
einen Künstler der Renaissance war ein Geburtsort nördlich der Alpen lange
Zeit geradezu ein Makel. Italien
war das künstlerische Mekka, in das dann auch folgerichtig viele
Nord-Vertreter der Zunft regelrecht pilgerten, um zu studieren, sich
handwerklich auszubilden oder sich ganz einfach unter südlicher Sonne
inspirieren zu lassen. Doch sind die künstlerischen „Nordlichter“ daher eher
als zweitrangig einzustufen? Mitnichten! Auch sie schufen Werke von
allerhöchstem Rang mit z.T. atemberaubendem intellektuellem Tiefgang! Am
Beispiel eines Jan van Eyck ist dies bereits mustergültig zu erkennen. Als
Mathis Gothart Nithart, genannt Grünewald, (vermutlich in den Jahren zwischen
1512 – 1516) die Bildtafeln des sog. Isenheimer Altars schuf, konnte er kaum
ahnen, dass sein Werk einmal in einem musealen Rahmen rund eine
Viertelmillion Besucher pro Jahr anlocken würde, denn zu deren Erbauung hatte
er es nun wahrlich nicht geschaffen. Vielmehr hatte es im Rahmen der ganz
speziellen Krankenpflege der Antoniter-Mönche eine besondere Aufgabe zu
erfüllen, der Begriff Psychotherapeutikum
hat hier durchaus seine Berechtigung! Vieles ist schon geschrieben worden
über dieses Werk, das zu Recht als eines der Hauptwerke der Renaissance
bezeichnet wird. Doch oftmals bleiben dabei dennoch Details unberücksichtigt,
die zu einem erweiterten Verständnis jedoch unerlässlich sind. Ich
lade Sie ein zu einer „Lesereise“ durch faszinierende Bildprogramme, um das
vielleicht bereits Gewusste um ein paar (entscheidende?) Aspekte zu
erweitern. Vermutlich wird es einige Überraschungen geben! |
|
Mittwoch,
28.01.2026 Beginn:
19:00 h
|
Mit
System verrückt Oder:
Über die Lesbarkeit von Kunst Teil
23 Joseph
Beuys Oder:
Im Zentrum steht der Anthropos |
Erwitte Festsaal Marx
Wirtschaft Am
Markt 11 |
Joseph
Beuys? War das nicht der, der mit Fett und Filz um sich geschmissen und das
dann als Kunst verkauft hat? Und dann war da doch auch noch diese verdreckte
Badewanne, deren Säuberung als Zerstörung eines Kunstwerkes galt und einen
Riesenskandal mit juristischem Nachspiel verursachte. Also ehrlich … !! Wohl
kaum ein anderer Künstler hat je ein Publikum derart polarisiert wie er:
Zwischen Genie und Scharlatan bewegen sich die Urteile über ihn – und wie
würden Sie entscheiden? Zugegeben,
sein Werk ist sperrig, ja muss unverständlich bleiben, wenn man es nicht vor einem spezifischen
historischen Hintergrund und eingebettet in einen sozialen Kontext
betrachtet. Aber Hand aufs Herz: Das war schon immer so! Joseph
Beuys (1921-1986) kann – und das hat er mit den wirklich ganz Großen seines
Faches gemeinsam – als umfassend gebildet gelten. Von einer sehr hohen Warte
aus (keinesfalls zu verwechseln mit dem berühmten Elfenbein-turm!) hatte auch
er naturwissenschaftliche, philosophische, theologische, vor allem aber
soziologische Aspekte stets im Blick. Ihnen
klingt das zu theoretisch und abgehoben? Dann seien Sie doch einfach dabei,
wenn der Referent es am 29.10. unternehmen wird, das Denken und Schaffen
dieses Mannes vom Kopf auf die Füße zu stellen und vielen Vor- und
Fehlurteilen die Luft abzulassen. Es mag dann sogar deutlich werden, dass die
Analysen eines Joseph Beuys und die durch seine Werke ver-mittelten
glasklaren humanen Botschaften (ja, richtig gelesen!) heute, nahezu ein
halbes Jahr-hundert nach seinem Tod, eine geradezu atem-beraubende Aktualität
besitzen! |
|
Montag,
02.02.2026 Beginn: 19:00 h
|
Mit
System verrückt Oder:
Über die Lesbarkeit von Kunst Teil
2 Griechenland
1 |
Ratssaal Ense Am Spring 4 |
Die
antike griechische Kunst umweht in der landläufigen Vorstellung oft eine
Konnotations-mixtur, die von „göttlicher Erhabenheit“ über sportlichen und
militärisch-heroischen Kampf bis hin zu scheinbar sinnfrei museal angehäuften
„kaputten Steinen“ reicht. Hier könnte man von Klärungsbedarf sprechen! Natürlich
gibt es nicht pauschal die griechische Kunst, ebensowenig
gibt es ja bekanntlich die Deutschen. Nun
gilt allerdings die griechische Welt der zweiten Hälfte des vorchristlichen
Jahrtausends gemeinhin als die Geburtsstätte und Wiege der abendländischen
Kultur auf breiter Front – der Begriff Renaissance
(=Wiedergeburt) wird dem noch mehr als 2000 Jahre später Rechnung tragen. Im
Umkehrschluss bedeutet dies jedoch, dass ein wirkliches Verständnis der
Neuzeit, die man in der Geschichtsschreibung mit der sog. Renaissance beginnen lässt, ohne die
Kenntnis ihrer antiken Wurzeln gar nicht möglich ist! So
wollen wir uns an diesem Abend anhand vieler Beispiele mit der Bild-(vielleicht
manchmal sogar wild-)gewordenen Welt der „alten Griechen“ beschäftigen und auch
etliche Facetten aufdecken, die bis in unser Hier und Jetzt hineinwirken,
deren Ursprünge jedoch mehr als einmal verblüffen dürften. |
|
Mittwoch,
09.02.2026 Beginn: 19:00 h
|
Mit
System verrückt Oder:
Über die Lesbarkeit von Kunst Teil
13 Welt
und Bildwelt des
Hieronymus
Bosch Oder: Der Teufel hat nicht nur den
Schnaps gemacht |
Rheine Vortragssaal
der VHS Neuenkirchener
Str. 22 |
Wohl
kaum jemand, der die Bilder dieses vor mehr als 500 Jahren verstorbenen
Künstlers betrachtet, kann sich einem Gemisch aus Faszination und Verwirrung
entziehen. Fragen nach Hintergründen und Bedeutung seiner Motive bzw. Symbole
drängen sich auf – und bleiben doch allzu oft unbeantwortet; zu fremd
erscheint uns heutigen Menschen das Dargestellte. Vergleiche mit Werken des
Surrealismus des 20. Jahrhunderts liegen nah und werden auch oft bemüht, aber
genauso, wie Letzterer nur aus seiner Entstehungszeit heraus zu erklären ist,
so muss man sich zum Verständnis der Werke Boschs die Mühe machen (oder auf
das Abenteuer einlassen!), das alltägliche und das geistig-religiöse Umfeld
des 15. und frühen 16. Jahrhunderts in Europa zu erkunden - und das hat es in
vielerlei Hinsicht richtig in sich: Der christliche Glaube wird nicht
einheitlich vertreten; unterschiedlichste Gruppierungen wetteifern um die
„rechten Lehren“. Sie unterscheiden sich von jener der römisch-katholischen
Kirche manchmal so drastisch, dass der Vatikan nur mit z.T. brutalster Gewalt
der Inquisition seinen Führungsanspruch innerhalb der Christenheit
durchzusetzen und unliebsame Gegenströmungen auszuschalten vermag. Die
Bildschöpfungen Boschs können nur wie ein Röntgenbild oder Dia vor einem
solchen Hinter-grund betrachtet werden, der sie gleichsam von hinten
durchstrahlt. Und so wollen wir am 09.02. das Licht in unserem
(kunst-)historischen Leuchtkasten anschalten, um sodann in den Bildern Boschs
auf Entdeckungsreise zu gehen. Und eines sei schon jetzt verraten: Es gibt
richtig viel zu entdecken - Überraschungen garantiert! |
|
Mittwoch,
18.02.2026 Beginn: 19:00 h
|
Kultcomic
Asterix „Die
spinnen, die Römer!“ — Oder vielleicht doch nicht? |
Warstein Haus
Kupferhammer |
Wer kennt
sie eigentlich nicht, die liebenswert chaotischen Bewohner jenes unbeugsamen
kleinen gallischen Dorfes, deren tollkühne Abenteuer seit 1968 schrittweise
auch einem deutschsprachigen Publikum zugänglich gemacht wurden?! Die
unangefochtenen Stars der Comic-Reihe sind zweifellos der kleine, gewitzte
gallische Krieger Asterix und sein dicker (pardon: kräftiger!) Freund Obelix.
Die geografische Lage ihres „Heimat-hafens“ wird dem Leser stets auf der
ersten Seite eines jeden Bandes mittels einer großen Lupe vor Augen geführt.
Bereits diese „Seh- und Lesehilfe“ hat es aber buchstäblich „in sich“: Sie
fordert stets zum ganz genauen Hinschauen auf, und dies gilt nicht nur für
die Bilder, sondern genauso für die Texte. Unter diese Lupe genommen
entpuppen sich nämlich beide als riesige Fundgruben von spitzfindigen
Anspielungen, Zitaten und Adaptionen wahrhaft großer Vor-Bilder. An diesem
Abend wollen auch wir sie deshalb zur
Hand nehmen und einmal schauen, wie subtil, geistreich und humorvoll die
europäische Kunst- und Kulturgeschichte in diesem wahrhaft kultigen Comic
nachzulesen ist. Beispiel:
Als Gericault 1818/19 das „Floß der Medusa“ malte, verschwieg er
geflissentlich, dass seiner Komposition ein Ereignis aus dem 1. Jahrhundert
v. Chr. zugrunde lag: Die Piraten waren mal wieder zwischen gallisch-römische
Fronten geraten und abgesoffen (s. Bild). Klar, oder? …. |
|
Montag,
23.02.2026 Beginn: 19:00 h
|
Mit
System verrückt Oder:
Über die Lesbarkeit von Kunst Teil
14 1517
– vorwärts,
rückwärts, seitwärts, ran Oder:
Luther bei die
Fische |
Rheine Vortragssaal
der VHS Neuenkirchener
Str. 22 |
Im
Herbst 1517 bekommt Papst Leo X. auf dem Dienstweg Post von einem ihm bis
dahin völlig unbekannten Martin Luther, sozusagen aus deut-schen Landen
frisch auf den Tisch! Leos Fehler: Er nimmt das „Mönchlein“, den Schreiber
der berühmten 95 Thesen, nicht ernst. Und als dieser am 31. Oktober 1517
seine schriftlich ausformulierte Kirchenkritik an die Tür der Schlosskirche
von Wittenberg nagelt und damit öffentlich macht, beweist er wahrhaft Mut,
ahnt aber ganz gewiss noch nichts von den letztlich welterschütternden Folgen
seines Tuns. Nun
ist Luther nicht der Erste, der an der „Verderbtheit“ der Institution Kirche
und ihres Personals Anstoß nimmt, nur mit ihm erreichen die Kritik und
schließlich die heftige Auseinandersetzung zweier Lager nie zuvor gekannte
Dimensionen. Dabei fungieren das gedruckte (!) Wort und das Bild als
zunehmend scharf geführte Waffen in der ersten großen Medienschlacht der
Neuzeit. Die Reformation macht aus Bildern Mittel einer breiten
„Verkündigung“; die kommunikative Schlacht gegen den kirchenpolitischen Gegner
bebildert entsprechend auch Polemik, Abwertung und Verhöhnung. So
wollen wir uns an diesem Abend anhand einer Fülle von Bildwerke hineindenken
und -sehen in die Zeit und die Ereignisse jener (religions-) politischen
Explosion, von der uns mittlerweile 5 Jahrhunderte trennen, deren
Erschütterungs-wellen aber immer noch deutlich zu spüren sind. |
|
Montag,
02.03.2026 Beginn: 19:00 h
|
Mit
System verrückt Oder:
Über die Lesbarkeit von Kunst Teil
3 Griechenland
2 – Rom 1 |
Ratssaal Ense Am Spring 4 |
Der
Lauf der Geschichte wurde und wird immer wieder durch kriegerische
Auseinandersetzungen entscheidend beeinflusst. Wenn wir für den Beginn jener
Phase der griechischen Kultur, die wir heute Hellenismus nennen, einen
Auslöser suchen, dann stoßen wir direkt auf Alexander den Großen und die
Eroberung seines Weltreiches. Dieses teilen seine Generäle sofort nach seinem
frühen Tod im Jahr 323 v. Chr. unter sich auf, friedlich geht anders! In
ihrem historischen Kielwasser entstehen noch etliche andere bedeutende
Reiche, insbesondere Pergamon, das der Galater, Pontos – und Rom! Letzterem werden
sich schließlich alle anderen unterwerfen müssen, aber dennoch haben sie alle
ihre besonderen Fasern zum großen roten Faden der Weltkultur beigesteuert,
man denke nur an den berühmten Pergamon-Altar in Berlin oder die Mozart-Oper Mitridate, ré di Ponto. Eines ist
jedoch immer wieder festzustellen: Stets ist Religion im Spiel! Allen, die
nach Herrschaft strebten oder diese zu verteidigen suchten, war daran
gelegen, sich z.B. Stammbäume zu basteln, die sie als „nicht ganz von dieser
Welt“ erscheinen lassen sollten. Wir kennen das bereits aus der ägyptischen
Kultur, das Gottes-gnadentum christlicher Herrscher beruht darauf, und mit
exakt dieser bildsprachlichen Wurst warf noch im 21. Jahrhundert ein George
W. Bush nach dem politischen Schinken. Kaum zu glauben? Dann schauen Sie doch
einfach selbst! |
|
Montag,
09.03.2026 Beginn:
19:00 h
|
Mit
System verrückt Oder:
Über die Lesbarkeit von Kunst Teil
15 Die Renaissance
nördlich der Alpen Altdorfer,
Holbein, Brueghel, Arcimboldo |
Rheine Vortragssaal
der VHS Neuenkirchener
Str. 22 |
Hätte
Papst Leo X. 1517 der Kritik am inner-betrieblichen und geschäftlichen
Gebaren der Kirche ein wenig mehr Aufmerksamkeit geschenkt, die Einheit der
Kirche hätte vermutlich nicht zur Disposition gestanden. Etwas
anders – aber doch ähnlich – liegt der Fall ein paar Jahre später, als
Heinrich VIII. von England den Papst bittet, seine Ehe mit Katharina von
Aragón mangels männlichen Nachwuchses aufzulösen. Der so gebetene Papst ist
Clemens VII., der diesem Ansinnen Heinrichs allerdings nicht entspricht,
worauf der mit der Lossagung von der römisch-katholischen Kirche und der
Gründung einer eigenständigen anglikanischen Kirche reagiert. Just zu dieser
Zeit arbeitet Hans Holbein d. J. als Hofmaler am englischen Hof … Drei
Jahrzehnte später werden die inzwischen stark dem Protestantismus zuneigenden
Nieder-länder zu spüren bekommen, was es heißt, wenn ein König in Spanien und
der Papst in Rom gemeinsame Sache machen, um die „verirrten Seelen“ wieder
auf den betriebswirtschaftlich rechten Weg zurückzuführen. Vor
diesem hochbrisanten (kirchen-)politischen Hintergrund malt Pieter Brueghel
d. Ä. einige seiner Hauptwerke. Der als „Bauern-Brueghel“ völlig falsch
„verschubladete“ Maler wird sich dem Blick des Eingeweihten als beißender
Kritiker der Obrigkeit offenbaren. Mit
Arcimboldo werden wir uns schließlich in jene kunstgeschichtliche Nische
begeben, die heute als Manierismus
bezeichnet wird, über die wir die Renaissance eher spielerisch verlassen und
uns auf das Barock einstimmen wollen.
|
|
Mittwoch,
18.03.2026 Beginn:
19:00 h
|
Homer in der bildenden Kunst Europas Oder: Achill und Odysseus mit ganz viel drumrum |
Erwitte Festsaal Marx
Wirtschaft Am
Markt 11 |
Wohl
jeder von uns ist schon irgendwann einmal nach einer regelrechten Odyssee
erschöpft und erleichtert am ersehnten Ziel angekommen, hat sich in neuen
Schuhen die Achilles-Sehne aufgescheuert, sich (vielleicht sogar ganz gerne)
becircen lassen oder sich am geschützt geglaubten Computer über einen „Trojaner“ geärgert; Brad Pitt
hätte ebenso auf eine satte Hollywood-Gage verzichten müssen wie wir auf
zahllose wunderbare Werke von Bildhauern und Malern aus mehr als zweieinhalb
Jahrtausenden, hätte es Homer, den angeblich blinden Dichter aus Chios, nicht
gegeben. Die großen Epen Ilias und Odyssee werden ihm
zugeschrieben und sie sind heute wie gestern eine schier unerschöpfliche
Quelle der Inspiration für Literaten, Musiker und bildende Künstler; für das
immer noch im Bau befindliche „Kultur-Haus Europa“ sind sie neben der Bibel
wohl die tragenden Wände! Ausgehend
von diesem Grundgedanken wollen wir in verschiedene Etagen und Räume dieses
Gebäudes hineinleuchten, ihre Einrichtungen und Funktionen erkennen und
vielleicht auch ein paar Versorgungsleitungen und Verbindungs-türen
entdecken, von deren Existenz wir bislang noch nicht einmal etwas geahnt
haben... |
|
Montag,
23.03.2026 Beginn:
19.00 h
|
Mit
System verrückt Oder:
Über die Lesbarkeit von Kunst Teil
16 Inszenierung der
Macht von Ludwig XIV. bis Napoleon I. Oder: Ein Bild lügt
mehr als tausend Worte |
Rheine Vortragssaal
der VHS Neuenkirchener
Str. 22 |
Wenn
heutzutage die Wahl eines politischen Kandidaten von der Auswahl seiner
Krawatte für den besonderen Fernseh-Auftritt abhängen kann (das ist leider
kein Witz!), dann mag man leicht glauben, im falschen (pardon: gefälschten!)
Film zu sein – und liegt dann mit dieser Einschätzung meistens goldrichtig. Macht
kennt im Grundsatz nur zwei bedeutsame Phasen: 1. Das Streben nach derselben
und 2. nach ihrem Erreichen das ständige Bemühen um ihren Erhalt. Dabei
bedient man sich nicht erst im Zeitalter digitaler Medien der Wirkmacht des
Bildes, das dazu entsprechend komponiert und bei dem das Dargestellte im
Dienste der Absicht inszeniert wird. Unverblümt sprach es seinerzeit ein
hochrangiger Mitarbeiter des office of global communication eines George W.
Bush in laufende Kameras und Mikrofone: „Wir achten nicht nur sehr genau
darauf, was der Präsident sagt, sondern auch, was das amerikanische Volk
sieht (…). Amerikaner sind meistens so viel beschäftigt, dass sie oft nicht
die Zeit haben, eine ganze Übertragung zu sehen. Und so wollen wir mit einem
Bild klarmachen, worum es geht.“ Bei aller Unverschämtheit dennoch im Grunde
ein alter Hut. Der
Referent wird versuchen, anhand einer Fülle von Beispielen, die vom kleinen,
eher unschein-baren Symbol bis zur Gesamtanlage eines ganzen Schlosses
reicht, die in langer Tradition stehende Macht-Ikonographie zweier Herrscher
aufzuzeigen, deren hervorstechende Eigen-schaften mit Sicherheit nicht
Bescheidenheit und Selbstzweifel waren – und deren Inszenierungen bis heute
Schule machen. |